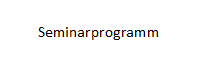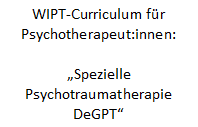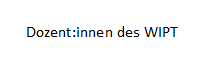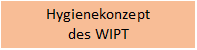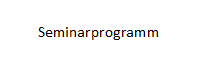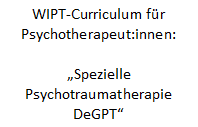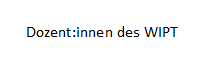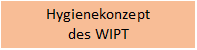|
Psychotrauma
Den Kern einer traumatischen Belastung bildet die überwältigende Erfahrung des Versagens der individuellen Schutz- und Handlungskompetenzen angesichts einer als existentiell erlebten Bedrohung. Kann diese Erfahrung nicht adäquat verarbeitet und integriert werden kommt es bei den Betroffenen zu einer existentiellen „Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses" (Riedesser/Fischer 1998/2009) und zur anhaltenden Stress- und Alarmreaktion. Insbesondere kommt es zu einer tiefen Verunsicherung bezüglich
- des eigenen Wertes, der eigenen Handlungsfähigkeit und der eigenen Sicherheit,
- der Verlässlichkeit von Beziehungen sowie
- der Kontrollierbarkeit und Vorhersagbarkeit „der Welt".
Typische psychische Symptome sind Angst und Spannung, Intrusionen, Vermeidungsverhalten, dissoziative Phänomene sowie eine erhöhte Stressanfälligkeit und Reaktionsbereitschaft. Korrelierend dazu konnte die moderne Hirnforschung spezifische strukturelle und funktionelle Gehirnveränderungen nachweisen.
Der seelische Verarbeitungsprozess nach einer belastenden Erfahrung lässt sich in einem Verlaufsmodell beschreiben. Im Falle eine „gelungenen" Verarbeitung wird die traumatisierende Erfahrung Teil der Erinnerung , etwas, „das war". Belastende innere und äußere Faktoren sowie Art und Ausmaß der traumatisierenden Erfahrung können den Verarbeitungsprozess stören, so dass er nicht zum Abschluss kommt, sondern sich als „traumatischer Prozess" fortsetzt, der sich in Traumafolgestörungen zeigt. Von besonderer Bedeutung für das Gelingen des Verarbeitungsprozesses ist eine gute soziale Unterstützung.
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD, F 43.1 n. ICD 10) und andere Traumafolgestörungen lassen sich als Ausdruck einer anhaltenden seelischen und körperlichen „Alarmreaktion" verstehen. Dabei können vielfältige seelische und körperliche Symptome auftreten, häufig mit einer Latenz nach den traumatisierenden Ereignissen. Je früher in der Lebensgeschichte und je anhaltender und belastender traumatisierende Erfahrungen sind, desto schwerwiegender sind in der Regel die Folgen. Es wird zwischen „einfachen" Traumafolgestörungen (Typ 1, einmaliges traumatisches Ereignis, PTSD n. ICD 10 F43.1) und „komplexen" Traumafolgestörungen (Folge wiederholter und/oder anhaltender traumatischer Erfahrungen = Typ 2-Trauma) unterschieden. Typ 1 und Typ 2 - Traumatisierungen sind klinisch durch unterschiedliche Verläufe gekennzeichnet sind und erfordern unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen. Häufige weitere Traumafolgestörungen und Komorbiditäten sind u. a. affektive Störungen wie Angststörungen und Depression, dissoziative Störungen, Persönlichkeitsstörungen, somatoforme Störungen, Eßstörungen und körperliche Erkrankungen.
Unter ressourcenorientierten Gesichtspunkten lassen sich die Symptome als Ausdruck von Bewältigungsbemühungen mit dem Ziel, die „seelische Verletzung" zu heilen und das Grunderleben von Sicherheit und Selbstwirksamkeit wiederherzustellen, verstehen. In der Therapie werden die „Heilungskräfte" der KlientInnen verstärkt und als Ressourcen genutzt, z. B. bei der Arbeit mit Imaginationen, mit innerer Distanzierung („Beobachterhaltung") und mit „inneren Anteilen" und „Ego-States".
Traumatherapie, d. h. die Behandlung traumatisierter Menschen,
hat die (Wieder-)herstellung des Gefühls der äusseren und inneren „Sicherheit" und eine Integration der traumatischen Erfahrung zum Ziel. Nach Janet werden 3 Phasen unterschieden: Stabilisierung, Traumabearbeitung und Trauer/Neuorientierung. Bei singulären Traumen folgt die Therapie in der Regel diesem Ablauf, bei komplex traumatisierten Patienten wird flexibler, meist im Wechsel stabilisierend und kleinschrittig traumakonfrontierend, gearbeitet.
Stabilisierung: Basis der beratenden und therapeutischen Arbeit mit Traumatisierten ist „Stabilität" der Klienten. Sie beinhaltet äußere Sicherheit, innere Sicherheit z. B. mit der Fähigkeit, belastende Affekte und Erinnerungen zu steuern und zu begrenzen sowie Sicherheit in der therapeutischen Beziehung. Dies gilt insbesondere für KlientInnen mit komplexen Traumafolgestörungen und dissoziativen Störungen.
Ressourcenorientiertes Vorgehen: Bereits bestehende Bewältigungsprozesse und -mechanismen werden gewürdigt und als Ressourcen genutzt, z. B. als „kontrollierte" Spaltung und Dissoziation in der Arbeit mit Imaginationen und der Arbeit mit „inneren Anteilen" in PITT (Psychodynamisch-Imaginative Psychotherapie n. Reddemann), der Ego-State-Therapie oder der Behandlung von schweren dissoziativen Störungen nach dem Konzept der „Strukturellen Dissoziation" (Nijenhuis/v. d. Hart).
Traumabearbeitung: Eine Traumakonfrontation ist ist der Regel anzustreben, setzt aber ausreichende Stabilität voraus. Bei singulären Traumatisierungen und Akuttraumatisierung ohne seelische Vorerkrankung (Typ 1 - Trauma) kann in der Regel früh mit der Traumabearbeitung begonnen werden (z. B. EMDR oder TF-KVT). Bei Typ-2-Traumastörungen und komplex traumatisierten Klienten besteht meist keine ausreichende Stabilität, so dass es zunächst darum geht, ausreichende äussere Sicherheit und innere Stabilität herzustellen. Auch gestaltet sich der Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung aufgrund von Ängsten, Misstrauen und traumatischen Beziehungserfahrungen häufig schwierig und langwierig. Eine Traumabearbeitung ist bei sorgfältiger Indikationsstellung und guter Vorbereitung z. B.als „fraktionierte" Traumakonfrontation möglich und sinnvoll, wenn trotz guter Stabilisierung weiter relevante traumabezogene Symptome persistieren.
Verfahren der Traumabearbeitung: Traumabearbeitung sollte unter geschützten Bedingungen erfolgen, um Retraumatisierungen zu vermeiden. Erprobte Verfahren sind z. B. EMDR , TF-KVT (traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie) und psychodynamische Verfahren, z. B. die Psychodynamisch-Imaginative Traumatherapie PITT. Und MPTT.
Trauer und Neuorientierung: Im letzten Teil der Therapie stehen Trauer über das Geschehene und Verlorene sowie die Umsetzung der Erfahrungen und Neuorientierungen, die im Therapieprozess gewachsen sind, im Mittelpunkt.
|
|